
Was macht heilsame Literatur aus?
Der Fuldaer Philosoph Dr. Christoph Quarch. Foto: Ulrich Mayer
Gastbeitrag
Der Philosoph Christoph Quarch hat über mehrere Jahre im Landkreis Miesbach Vorträge und Philosophische Tage gehalten und ist den Menschen in der Region auch durch seine zahlreichen Bücher und Philosophischen Reisen ein Begriff. Zum Ostermontag schenkt er uns dieses Interview.
Sie berührt uns im Herzen – oder in der Seele; egal, wie Sie diese Tiefendimension unseres Selbst nennen wollen, die wir in all der Betriebsamkeit und Geschäftigkeit unseres Alltags oft vergessen. Man könnte auch sagen, sie durchdringt unsere Oberfläche, auf der wir uns oft eingerichtet haben. Franz Kafka meinte, ein Buch müsse „die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“. Das Bild ist mir persönlich etwas zu grob. Ich würde eher sagen: Die heilende Kraft der Literatur zeigt sich darin, dass sie die gefrorene Oberfläche unsere Seele aufzutauen vermag und uns dadurch die Möglichkeit gibt, unsere Mitte und unser Zentrum zu finden. Und genau das braucht es, um resilient mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen.

An der Mangfall beim Philosophischen Tag 2018. Foto: Monika Ziegler
Erfahrungen von Krankheit und Leid erscheinen vielen sinnlos. Wodurch kann Literatur Sinn stiften?
Ich glaube, viele Menschen leiden darunter, dass sie den Blick fürs Ganze verloren haben. Sie schauen nur auf sich, auf ihre persönliche Not oder auch Krankheit. Das kann man niemandem vorwerfen, denn eine Krankheit fordert unsere Aufmerksamkeit, ob wir wollen oder nicht; aber es ist trotzdem nicht gut, wenn man sie nicht in ein größeres Bild einordnen kann. Und da hilft die Literatur. Sie erzählt Geschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Sie öffnet neue Horizonte, bietet andere Sichtweisen, die es mir erlauben, mich anders zu meiner Krankheit oder zu meinem Leid zu verhalten. Wir wissen inzwischen sehr gut, dass eine veränderte Kontextualisierung viel zum Heilungsgeschehen beitragen kann
Können wir durch Lesen gesündere Menschen werden? Was überhaupt heißt dann „gesünder“?
Was Gesundheit genau ausmacht, ist eine Frage, die ich lieber den Fachleuten überlasse. Mir gefällt allerdings die alte Definition der Hippokratischen Mediziner, die sagten: Gesund ist der Mensch dann, wenn er mit sich im Einklang ist: wenn seine Körper in Balance ist, wenn seine Seele mit sich im Reinen ist, und wenn Körper und Seele übereinstimmen. Wenn man Gesundheit so umfassend definiert, dann kann gute Literatur ganz gewiss zu unserer Gesundheit beitragen – genauso wie gute Musik, schöne Kunst und andere Kulturerzeugnisse.
Lesen kann Resilienz fördern
Ist Lesen eine Form von Therapie? Sollte sie es öfter sein?
Das wäre mir zu hoch gegriffen. Lesen kann eine Form der Therapie sein – aber nur, wenn die Leserin oder Leser einen Text auch wirklich liest. Lesen ist nämlich nicht gleich lesen. Ich kann einen Text so lesen, wie ich mit der Handy-Kamera durch die Gegend laufe: Ich nehme Informationen auf, aber ich nehme den Sinn nicht wahr. So ein oberflächliches Lesen lässt einen an der Oberfläche und führt einen nicht in die Tiefe. Aber wenn ich mich wirklich auf eine Geschichte einlasse, mich gleichsam von ihr anziehen und fesseln lasse, dann kann sie etwas Überraschendes in mir auslösen und Ressourcen ansprechen, die meiner Resilienz oder Immunkraft förderlich sind.
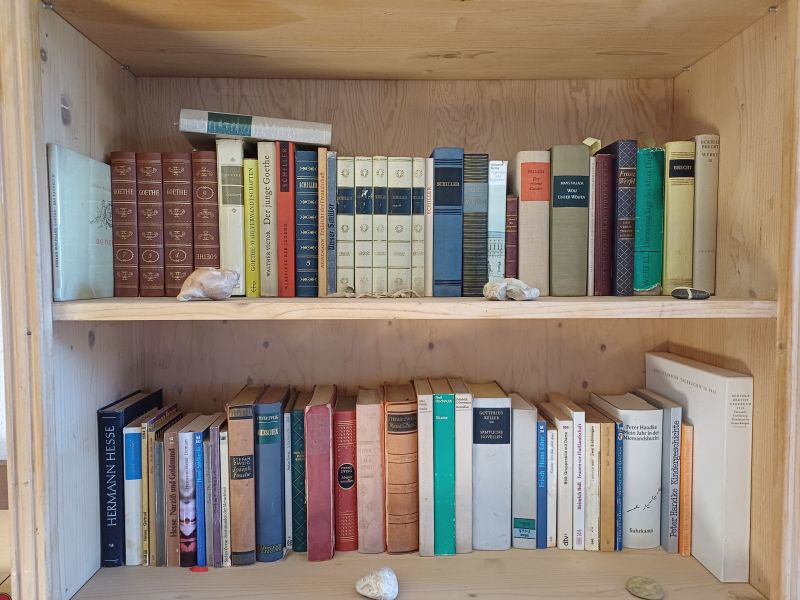
Gute Literatur inspiriert. Foto: Monika Ziegler
Auf welche Weise profitieren wir davon, wenn wir uns mit dem Schicksal einer Romanfigur identifizieren?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich immer davon profitieren. Es gibt auch ziemlich toxische Romanfiguren, mit denen ich mich ungern identifizieren würde. Oder denken Sie an die vielen jungen Männer, die sich angeblich nach der Lektüre von Goethes „Werther“ in einem Überschwang von Gefühlsaufwallung das Leben genommen haben. Das wäre mir dann doch zu viel der Identifikation. Aber mal von solchen Problemfällen abgesehen: Wenn ich mich mit einer literarischen Gestalt identifiziere, ist das wie wenn ich auf eine Reise gehe: Ich lerne die Welt, mit anderen Augen zu sehen. Und wenn diese Augen gesund sind – wohlwollend, weise, wach oder wie auch immer –, dann wird das auch meiner Gesundheit förderlich sein.
Literatur kann weibliches Selbstbewusstsein stärken
Romane können trösten – wie beeinflussen sie unser Seelenheil noch?
Da ist vieles möglich. Ein negatives Beispiel hatte ich mit Goethes Werther ja schon angesprochen. Aber es gibt auch jede Menge positive Beispiele. Man sagt ja, Homer habe mit seinen Epen die Griechen erzogen. Und tatsächlich haben seine Helden wie Hektor oder Odysseus das Potenzial, junge Menschen zu motivieren, mutig und tapfer dem Leben zu begegnen. Die Frauengestalten bei Jane Austen haben vielen ihrer Leserinnen in einem neuen weiblichen Selbstbewusstsein bestärkt. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Literatur ihr Publikum auf neue Wege gebracht hat.
Machen uns bestimmte Geschichten resilienter gegenüber den Zumutungen unserer Zeit?
Ich denke ja; allerdings nur solche Geschichten, die uns etwas von der Größe und Schönheit des Menschen erzählen. All die selbstquälerische Literatur, mit der Autoren eigentlich nur sich selbst aber ganz sicher nicht ihr Publikum heilen wollen, scheinen mir der Resilienz eher abträglich zu sein. Auch bei Krimis, Gewaltdarstellungen und dergleichen, bin ich eher skeptisch. Es klingt vielleicht konservativ, aber ich glaube tatsächlich an die Kraft dessen, was man früher die „schöne Literatur“ nannte. Denn das ist die Literatur die unsere Seele nährt und unser Immunsystem stärkt.
Literatur kann Selbstwahrnehmung verändern
Hilft Literatur dabei, die eigene Befindlichkeit besser zu verstehen und zu deuten?
Ja, ich sagte ja schon: Sie ermöglicht es mir, mein Leiden, meine Krankheit oder einfach nur meinen Kummer mit anderen Augen zu sehen und mich folglich auch anders zu mir selbst zu verhalten. Weil Krankheit und Gesundheit zu einem gewissen Grad auch immer Konstruktionen meiner Selbstwahrnehmung sind, kann eine geänderte Selbstwahrnehmung heilsam sein.
Worin liegt das Potenzial fiktiver Texte gegenüber Sach- und Ratgeberliteratur?
Sachbücher und Ratgeber informieren. Fiktive Texte inspirieren.
Was macht eine humane Medizin aus? Wie kann Literatur zu einer humaneren Medizin beitragen?
Eine humane Medizin reduziert den Menschen nicht auf objektivierbare und quantifizierbare Daten. Sie nimmt den Patienten darin ernst, wie er sich selbst erlebt – eben nicht nur als Körper, sondern auch als Geist und als Seele. Und entsprechend adressiert sie den Patienten auch nicht nur als einen biochemischen Apparat, der gelegentlich einer Reparatur unterzogen werden muss, sondern als ein komplexes System, indem leibliche, seelische und geistige Aspekte unauflöslich ineinander verschlungen sind. Deshalb sieht eine humane Medizin den Menschen auch immer in seiner einmaligen, individuellen Situation – und nicht als gesichtsloses Objekt, auf das allgemein erprobte Methoden oder Techniken angewandt werden können.
Zum Weiterlesen: Gott ist tot, es lebe das Unendliche